Die digitale Transformation ist nicht nur ein organisatorischer sondern auch ein technologischer Veränderungsprozess. Unabhängig davon, ob das Ziel darin besteht, den Ertrag zu steigern, papierlos zu arbeiten oder die Produktivität in der Fertigung durch die Digitalisierung zu erhöhen, erfordert eine erfolgreiche Transformation letztendlich die Zu- und Abstimmung auf allen Ebenen des Unternehmens.
Die sorgfältige und frühzeitige Zusammenstellung eines Projektteams, in dem alle von der digitalen Transformation betroffenen Gruppen vertreten sind, ist von entscheidender Bedeutung. Dieses Team muss gemeinsam Projektchartas entwickeln, in denen die Vision, der Umfang und die Prioritäten detailliert beschrieben werden, gefolgt von Roadmaps und Meilensteinplänen, die die Perspektiven der Stakeholder zusammenfassen. Die Erstellung, Verbreitung und Anpassung dieser Dokumente stellt sicher, dass Projekte in die richtige Richtung starten und im weiteren Verlauf auf Kurs bleiben.
Geschäftsziele
Die Fertigungsautomatisierung kann vielen Zielen dienen: Reduzierung von Ausschuss, Verfolgung und Rückverfolgung von Material, Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) oder Vereinfachung komplexer Betriebsszenarien. Die Identifizierung dieser Ziele ist oft ein evolutionärer Prozess, da die Inputs vom Projektteam gesammelt und durch Iteration verfeinert werden.
Bewährte Verfahren bestehen darin, die Ziele direkt mit dem Geschäftswert und den Gewinn- und Verlustkennzahlen wie Ausschuss, First-Pass-Yield (FPY), Zykluszeit (CT), OEE oder Energie pro Einheit zu verknüpfen. Sobald die Ziele klar sind, muss die Unternehmensleitung eine kohärente Vision festlegen, Grenzen definieren und den geschäftlichen Kontext, die Ziele und die Maßnahmen schaffen, die das Team durch das „eiserne Dreieck“ aus Umfang, Zeitplan und Ressourcen führen.
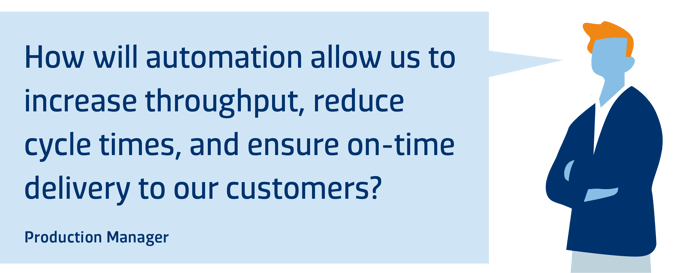
Leitprinzipien
Aufgrund der Komplexität und der mit digitalen Transformationsprojekten verbundenen Risiken ist eine strenge Projektmanagementdisziplin unerlässlich. Es sollte ein zertifizierter Projektmanager (PM) mit umfassender und fundierter Fachkompetenz und Erfahrung im Bereich fortschrittlicher Fertigungsautomatisierungsprojekte hinzugezogen werden.
Es hat sich gezeigt, dass eine frühzeitige Planung die Gesamtkosten senkt und die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht. Der PM stellt sicher, dass das Projekt angemessen geplant und auf den spezifischen Kontext zugeschnitten ist, wobei er auf Wissensbereiche wie Integration, Umfang, Zeitplan, Kosten, Qualität, Kommunikation, Risiko, Beschaffung und Stakeholder-Management zurückgreift.
Projektsteuerung & Takt
- Lenkungsgruppe: Die Bereiche Betrieb, Qualität, Wartung, IT/OT und Finanzen sollten an regelmäßigen Überprüfungen teilnehmen, um Entscheidungen zu treffen und Prioritäten abzustimmen.
- Roadmap Takt: Roadmaps sollten schrittweise umgesetzt werden, wobei jede Phase einen messbaren Mehrwert und die Voraussetzungen für die nächste Phase schafft.
Projektteams
Die Zusammenarbeit mit Vertretern der Gruppen, die von den Veränderungen am stärksten betroffen sind, liefert wertvolle Beiträge und sichert die Akzeptanz der Endnutzer. Die Akzeptanz und Einführung neuer Systeme und Prozesse ist am größten, wenn die Endnutzer aktiv einbezogen werden. Diese Fachexperten helfen dem Projektmanager, die aktuelle Situation zu verstehen und praktische, effektive Lösungen zu entwickeln.
Durch die Rekrutierung wichtiger Mitarbeiter aus der Produktion als Fachexperten wird sichergestellt, dass bisherige Erfahrungen genutzt werden, anstatt mühsam neu erlernt werden zu müssen. Mitarbeiter aus den Bereichen Finanzen und Betrieb sorgen dafür, dass das Projekt im Rahmen des Budgets und der Praktikabilität bleibt. Diese Gruppe von „Change Agents“ mit fundierten Fachkenntnissen ist unerlässlich, um Prioritäten auszugleichen, Bedenken anzusprechen und die Dynamik aufrechtzuerhalten, wenn Herausforderungen auftreten.

Projektplanung
Wenn die Vision hinreichend detailliert ist, die Prioritäten umrissen sind und ein grober Fahr-und Zeitplan erstellt wurde, kann die formale Konzeption beginnen. Obwohl ein Projektplan erst nach Abschluss des Projekts wirklich fertiggestellt ist, haben die Beteiligten einen gemeinsamen Ausgangspunkt und einen Rahmen, in dem sie die notwendigen Entscheidungen treffen können.
Festlegung der Prioritäten
In der Planungsphase beginnen der Projektmanager und die Beteiligten mit der Feinabstimmung der Prioritäten für das Projekt. Von da an wird es notwendig, den Projektumfang neu zu bewerten und zu verfeinern. Die Prioritäten werden oft nur vage formuliert, aber durch die schrittweise Ausarbeitung werden die Prioritäten ständig überprüft, geklärt und abgestimmt. Die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der Prioritäten zu Beginn der Planungsphase ist entscheidend. Im Idealfall stimmen alle Beteiligten überein, da die Prioritäten während der Durchführung, Überprüfung und Kontrolle des Projekts ständig im Mittelpunkt stehen.
Projektfahrplan
Ein Projektplan ist vom Konzept her vergleichbar mit einer Straßenkarte, die für die Navigation durch das Land verwendet wird. Sie liefert die Informationen, die benötigt werden, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen und gibt einen Überblick über die Gesamtroute, bietet aber auch die nötige Flexibilität für Fortschrittsbeurteilungen, Kurskorrekturen und Änderungen der Kadenz.
Der anfängliche Projektplan ist ein grobes Planungsinstrument auf hohem Niveau, das sich im Laufe des Projekts ständig weiterentwickelt. Auf der Grundlage des Fachwissens des Projektleiters, des Projektteams, der Systemarchitekten und der Beteiligten konzentriert sich die Roadmap auf die Abfolge der wichtigsten Meilensteine gemäß Priorität, definierten Aufgaben und möglichen Risiken. Berücksichtigt werden sollten: Größe und Kapazität des Teams, der Umfang und die Komplexität des Projekts, Abhängigkeiten und Probleme im Zusammenhang mit der Technologie, organisatorischer Akzeptanz und Annahme, die teilweise oder vollständige Änderung grundlegender Geschäftspraktiken oder der Zugang zu Ressourcen und Fachleuten.
Roadmaps sind ein effektives Kommunikationsinstrument, mit dem sichergestellt wird, dass der PM, die Stakeholder und das Projektteam hinsichtlich des Umfangs und der Abfolge der Arbeiten kontinuierlich aufeinander abgestimmt sind. Anfängliche Einschätzungen der Dauer und des Aufwands sollten vom Team nicht als Verpflichtungen aufgefasst werden, sondern vielmehr dazu dienen, allen Beteiligten ein Verständnis dafür zu vermitteln, wie das Projekt zusammengefügt und realisiert werden kann. Darüber hinaus sollte der Projektplan konsistent und auf die gemeinsame Vision und den Umfang des Projekts festgelegt sein, damit der PM, die Stakeholder und das Team diese Teilbereiche gemeinsam weiterentwickeln können. Nicht zuletzt soll gewährleistet sein, dass es nur begrenzte Möglichkeiten gibt den Umfang des Projekts anders zu interpretieren.
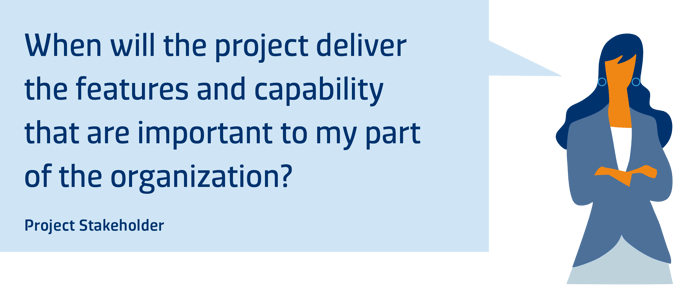
Projektzeitpläne
Die Entwicklung von Zeitplänen erfordert Expertenwissen, sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf den Prozess und die Struktur. Zeitpläne werden im Projektplan als sehr grobe, umfangreiche Schätzungen für die Erreichung von Meilensteinen dargestellt. Sie enthalten alle derzeit bekannten Abhängigkeiten, die zeitliche Beschränkungen begründen. Der Zeitplan kann weiter ausgearbeitet und als Work Breakdown Structure (WBS) oder als nach Prioritäten geordnetes Produkt- oder Projekt-Backlog strukturiert werden. Der PM und sein Team beginnen damit, Ressourcen zuzuweisen und Ziele weiter zu definieren und zu priorisieren. Ein natürlicher nächster Schritt ist dann die Schätzung des Aufwands und der Dauer und damit die Entwicklung eines Projektzeitplans, der als Basisplan verwendet wird.
Der Prozess der Aufwandsschätzung und Aufgabenreihenfolge wird wiederum stark von der Projektmethodik beeinflusst. Unabhängig davon, ob das Projekt nach einer traditionellen oder agilen Projektmethodik verwaltet wird, ist es unerlässlich, dass die Ressourcen, die die Arbeit tatsächlich „ausführen“, in die Entwicklung des Plans einbezogen werden. Es genügt zu sagen, dass der Prozess anspruchsvoll ist und das Fachwissen und die Anleitung eines erfahrenen Projektmanagers erfordert. Die Schätzungen sollten letztendlich das Wissen der Teammitglieder widerspiegeln, die die Arbeit ausführen – und nicht die Wünsche des ausführenden Sponsors oder des Projektmanagers. Alle geplanten Arbeiten erfordern die Zustimmung und das Engagement des Teams, das die Arbeit ausführt, sowie der Stakeholder, die das Projekt finanzieren.
Proof of Concept
Ein Proof of Concept (PoC) ist eine wertvolle Methode, um Annahmen mit begrenztem Risiko zu validieren. Ein PoC kann den Nutzen demonstrieren, den Umfang und die Prioritäten aufzeigen und die Stakeholder vor einer breiteren Einführung aufeinander abstimmen. Beispielsweise kann die Integration und Automatisierung einer einzelnen Anlage Erkenntnisse und Vertrauen schaffen, bevor die gesamte Produktionslinie umgestellt wird.
Best Practice: Skalieren Sie, was funktioniert. Vermeiden Sie Chaos, indem Sie frühzeitig Erfolgskriterien definieren und einen klaren Weg zur Erweiterung bewährter Konzepte festlegen.
Change Management
Rollenbasierte Schulungen, die Befähigung der Bediener und KPIs zur Akzeptanz (z. B. Nutzung, Aufgabenzeit, Ausnahmeraten) sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Veränderungen greifen. Frühzeitiges Engagement, transparente Kommunikation und die Berücksichtigung von Ergonomie und Sicherheit tragen dazu bei, Vertrauen aufzubauen.
Ebenso wichtig ist es, frühzeitig die Grundsätze der Datenhoheit und des Stammdatenmanagements (MDM) zu verankern: Standardkennungen (LotID, ToolID, ChamberID, RecipeID, Operation) und Glossare für Metriken und Codes verhindern Unklarheiten und gewährleisten Interoperabilität.
Projektdurchführung
Wenn Projekte in die Umsetzungsphase eintreten, sind regelmäßige Kommunikation und proaktives Risikomanagement unerlässlich. Der Projektmanager überwacht Umfang, Qualität und Ressourcen und sorgt gleichzeitig dafür, dass Wissen und Erfahrungen im Laufe des Projekts erfasst werden.
Hüten Sie sich vor häufigen Fallstricken:
- Projektwildwuchs ohne Steuerung
- Unklare Datenhoheit
- “Pilot purgatory” — nie über PoCs hinaus skalieren
- Integration vernachlässigen und voreilig KI nachjagen
Bewerten & Feiern
Die Bewertung des Projekts an wichtigen Meilensteinen ist ein wichtiger Prozess, der dem Projektmanager, dem Team und den Stakeholdern die Möglichkeit bietet, die Projektergebnisse anhand des Projektplans zu überprüfen und zu bewerten, um wichtige Informationen zu sammeln – wurde die Vision erreicht? Hat die Projektstrukturplanung (WBS) die Abfolge, Abhängigkeiten, den Aufwand und die Dauer angemessen definiert? Gab es Risiken, die anders hätten identifiziert oder gemindert werden können? Gab es Kommunikationsprobleme mit relevanten Stakeholdern – Führungskräfte, Organisation oder andere? Wurden die Geschäftsziele und erwarteten Vorteile realisiert?
In der agilen Terminologie wird dies als Sprint-Retrospektive bezeichnet. Die Stakeholder werden gebeten, konstruktive Beiträge zu leisten, um sicherzustellen, dass die nächste Iteration des Projekts auf den Erfahrungen der vorherigen basiert. In Wasserfallprojekten wird in einer Abschlussphase ein ähnliches Ergebnis erzielt, während zusätzlich eine Projektphase oder das Projekt selbst formell abgeschlossen wird. Der Abschluss oder die Retrospektive bietet die Gelegenheit, über Erfolge und Misserfolge nachzudenken, das Lernen in der Organisation zu fördern und die Erfahrungen auf der Grundlage der Projektergebnisse zu festigen. Es ist auch die Gelegenheit, die nächsten Iterationen auf der Grundlage der tatsächlichen Ergebnisse zu definieren und, was wichtig ist, den Erfolg und die harte Arbeit der gesamten Organisation zur Erreichung der Ergebnisse zu feiern.
Groß denken, klein anfangen, schnell handeln
Groß angelegte organisatorische Veränderungsprojekte erfordern ein kompetentes Projektmanagement und eine disziplinierte Umsetzung. Durch die Verknüpfung von Aktionen mit dem Unternehmenswert, die Einrichtung einer starken Steuerung, die schrittweise Umsetzung und die Einbettung des Change Managements können Hersteller häufige Fallstricke vermeiden.
Leben Sie das Motto: „Groß denken, klein anfangen, schnell handeln.“ Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jede Phase einen messbaren Wert liefert, die Grundlage für die nächste Phase schafft und das Unternehmen für einen dauerhaften Transformationserfolg positioniert..
